Der Mythos des individuellen Denkens und die Macht der kollektiven Weisheit
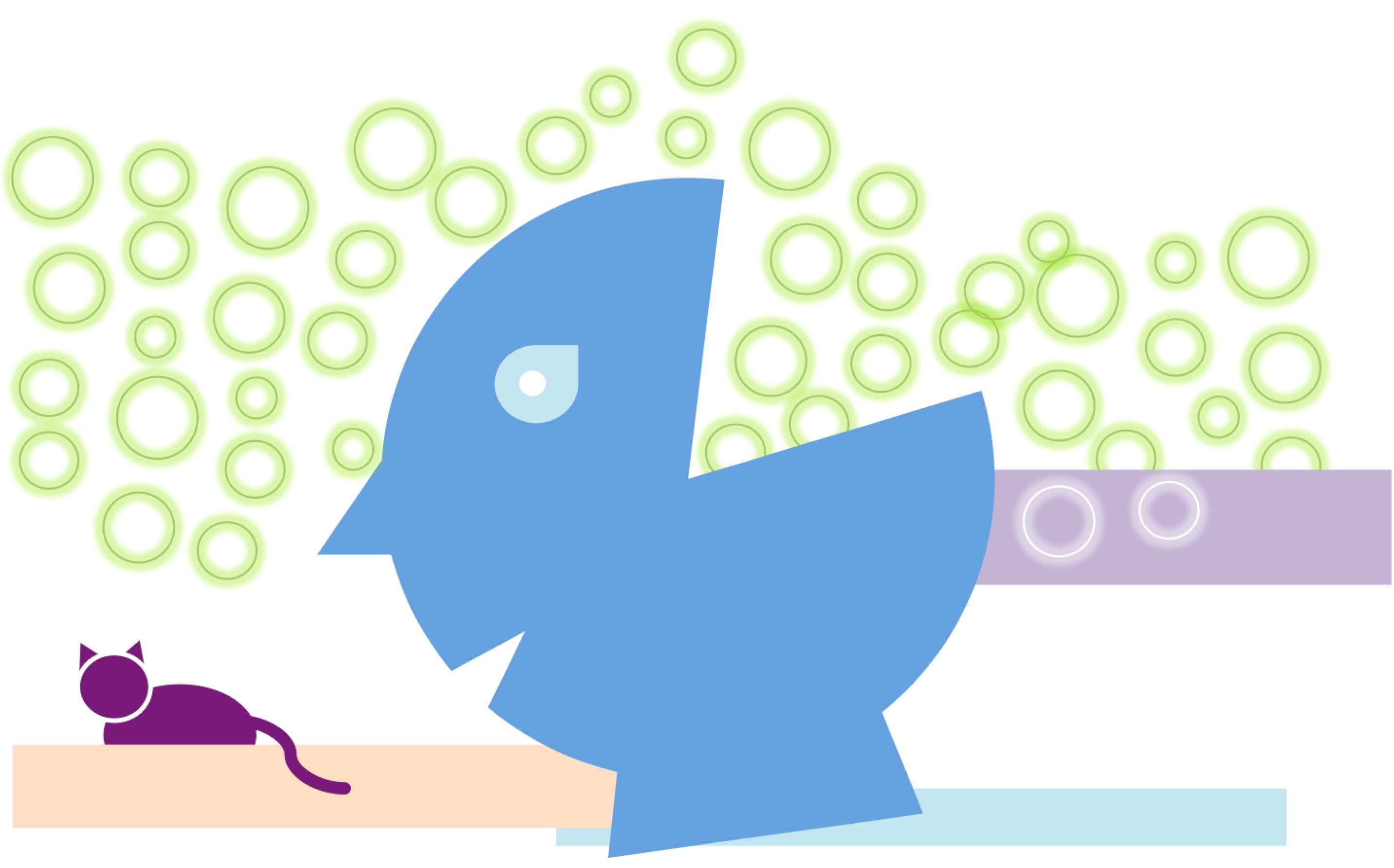
Den Tag verbrachte ich zuhause. Nach dem Frühstück kümmerte ich mich um etwas, das ich schon lange erledigen wollte: Meine HiFi-Anlage sollte einen neuen Platz im Regal bekommen. Und ich wollte meinen analogen Dual-Plattenspieler, der mich seit Studententagen begleitet, wieder in Betrieb nehmen; es dauerte einige Zeit, bis alles an seinem Platz und verkabelt war. Dann legte ich eine ewig nicht mehr gehörte LP auf, bekam Hunger und machte mir ein Brot.
Langsam machte ich mir Gedanken darüber, dass unsere Katze ungewöhnlich lang unterwegs war. Da sie sich kürzlich wieder in der Garage der Nachbarn über Nacht eingeschlossen hatte, hätte ich sie zu meiner Beruhigung lieber im Haus gewusst, bevor ich in die Stadt fuhr. Ich ging in den Garten und rief sie: nichts von ihr zu sehen. „Ok, dann eben nicht, sie wird schon kommen“, beruhigte ich mich selber und ging zurück in die Wohnung. Da kam sie mir entgegen, sie hatte den Vormittag wohl schlafend im Haus verbracht. Jetzt fiel es mir wieder ein: Sie hatte sich morgens an der Terrassentür herumgedrückt, ich hatte ihr probeweise aufgemacht. Sie hatte die Nase rausgesteckt, sich umgesehen, war dann umgedreht und hatte sich entschieden, lieber ein Nickerchen zu machen. Wie Katzen so sind. Ich hatte es mir lediglich falsch gemerkt.
Was wäre gewesen, wenn sie, wie von mir eigentlich erwartet und erinnert, draußen gewesen und auf mein Rufen hin zum Haus gekommen wäre? Nichts! Ich wäre nicht einmal irritiert worden, weil es meinen Erwartungen entsprochen hätte, obwohl es in Wirklichkeit ja anders war: sie hatte im Haus geschlafen.
Die Wissens-Illusion
Bevor Sie jetzt denken, ich hätte sie nicht mehr alle, erzähle ich Ihnen besser, warum ich dieses banale Erlebnis als Einleitung gewählt habe: Die Situation ist die perfekte Illustration einer der Thesen, die Steven Sloman und Philip Fernbach in Ihrem Buch „The Knowledge Illusion: The myth of individual thought and the power of collective wisdom“1 vertreten: Wir wissen viel weniger als wir zu wissen glauben und sehr viel vermeintliches Wissen entnehmen wir einfach der uns umgebenden Realität, die wir wie eine persönliche Bibliothek benutzen, in der wir immer dann „nachschlagen“, wenn wir meinen, etwas zu wissen, es aber in Wirklichkeit nicht tun:
„The secret to our success is that we live in a world in which knowledge is all around us. It is in the things we make, in our bodies and workspaces, and in other people. We live in a community of knowledge.“
In meiner Geschichte war ich zunächst felsenfest davon überzeugt, dass unsere Katze draußen unterwegs war. Ich benötigte die Realität der Katze, die mir von drinnen entgegenkommt und deshalb nicht draußen gewesen sein kann, um mein Wissen zu korrigieren. Mein angebliches Wissen war in Wahrheit nur die Illusion von Wissen. Unter anderem darum und um die daraus resultierenden Konsequenzen geht es den beiden Autoren in ihrem Buch.
Wir sind ignoranter als wir denken
Eine der Hauptthesen der beiden Autoren ist, dass wir – individuell – wesentlich weniger können als wir glauben, dass wir – als Individuen – eine sehr begrenzte Kapazität besitzen, Informationen zu verarbeiten oder Risiken richtig einzuschätzen und dass wir mit unserem individuellen Wissen maximal die Oberfläche der tatsächlichen Komplexität der Welt ankratzen. Dabei werden wir nicht gewahr, wie wenig wir verstehen und sind uns unseres „Wissens“ über Dinge, die wir kaum verstanden haben, viel zu sicher.
Diese Knowledge Illusion leuchten Sloman und Fernbach in ihrem Buch aus; sie illustrieren und begründen sie mit vielen Beispielen und Forschungsergebnissen, z.B. der sog. „Illusion of Explanatory Depth“: In einer Reihe von Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass Menschen dazu neigen, ihr Verständnis eines Sachverhaltes oft zunächst zu überschätzen, und nachdem sie versucht haben, den Sachverhalt zu erläutern, signifikant geringer bewerten als vor dem Erklärungsversuch. Prägnant illustrieren sie dies an der Funktionsweise eines WC: Die meisten Menschen glauben, sie wüssten, wie ein WC funktioniere, können die Funktionsweise aber nicht korrekt und vollständig erläutern, wenn sie darum gebeten werden. Ein anderes Beispiel: Wenn Menschen aufgefordert werden, ein normales Fahrrad zu zeichnen, kommen teils physikalisch unmögliche Konstruktionen heraus.
Individuelle Ignoranz und kollektive Kompetenz
Den Autoren geht es nun weniger um unsere individuelle Ignoranz und Begrenztheit, sondern vor allem darum, dass wir glauben, viel weniger ignorant zu sein, oder, um es positiv auszudrücken, viel kompetenter zu sein, als wir es in Wahrheit sind. Die Autoren behaupten, wir scheitern nur deshalb nicht an der Komplexität unserer Umwelt und bleiben handlungsfähig, weil wir sie radikal reduzieren: Wir ignorieren Komplexität, indem wir unsere eigene Fähigkeit, Dinge zu verstehen, maßlos überschätzen und auf der Basis dieser Überzeugung handeln:
„We tolerate complexity by failing to recognize it. That’s the illusion of understanding.“
Wenn die These von der erheblichen Begrenztheit unseres individuellen Wissens und Verstehens stimmt: Wieso erreichen wir als Menschheit dann trotzdem überhaupt so viel?
Sloman und Fernbach antworten darauf, wir seien zwar individuell ignorant, aber kollektiv kompetent. Wir profitierten, ohne dass wir dies vor uns selbst und den anderen zugeben würden, von der „Community of Knowledge“ aller Menschen in der Gegenwart und der Vergangenheit.
Das eigentliche Problem sehen die Autoren nicht in dieser verteilten Natur unseres Wissens, sondern in unserer generellen Unfähigkeit, das, was wir als Individuen selber wissen, exakt von dem zu unterscheiden, was außerhalb unseres Hirns gespeichert ist und auf das wir (erst) zugreifen können (aber auch müssen), falls wir es benötigen:
„The curse of knowledge is that we tend to think what is in our heads is in the head of others. In the knowledge illusion, we tend to think what is in others’ heads is in our heads. In both cases, we fail to discern who knows what.“
Zwerge, überall nur Zwerge
Wenn Sie sich im Business-Umfeld bewegen, ist Ihnen sicher einmal die Phrase „Dwarfs, standing on the shoulders of giants“ untergekommen, die vor einiger Zeit durch Konferenzvorträge und Keynotes grassierte. Eigentlich meint sie etwas Richtiges und laut Wikipedia2 ist die Phrase auch schon sehr alt, aber eigentlich müsste sie man mit der Erkenntnis von Sloman & Fernbach ein wenig anders formulieren: Wir sind Zwerge, die neben vielen anderen Zwergen auf den Schultern wiederum vieler anderer Zwerge stehen. Die Zwerge, auf denen wir stehen, erscheinen uns lediglich als Riesen3, weil wir immer wieder individuelles Wissen, Verständnis und Können mit der Weisheit der Gemeinschaft verwechseln.
In der Einleitung schreiben sie:
„We rely on abstract knowledge, vague and unanalyzed. […] In fact, most knowledge is little more than a bunch of associations, high-level links between objects or people that aren’t broken down into detailed stories.“
Im Weiteren machen sie sich Gedanken darüber, warum das eigentlich so ist.
Unsere Gedanken dienen dem Handeln…
…behaupten die beiden Autoren jedenfalls: Das Denken entwickelte sich evolutionär als eine Erweiterung der Fähigkeit zum effektiven Handeln. Es hilft uns dabei, das besser zu tun, was wir tun müssen, um ein Ziel zu erreichen. Nachdenken befähigt uns dazu, aus einer Reihe von Handlungsalternativen die beste herauszusuchen, indem wir die Resultate jeder einzelnen Alternative voraussagen oder zumindest abschätzen und dann diejenige auswählen und ausführen, welche die besten Ergebnisse zeitigt.
Sobald Lebewesen Neuronen und Nervensysteme entwickelten, explodierte die Komplexität ihrer Handlungen und entwickelte sich mit einer erstaunlichen Rate weiter. Neuronen und das Nervensystem bilden die Grundlage für ein flexibles System, das die Evolution benutzt, um zunehmend komplexere, informationsverarbeitende Algorithmen zu programmieren: Eine Meeres-Nacktschnecke besitzt ca. 18.000 Neuronen, Fruchtfliegen und Hummer haben davon etwa 100.000, Honigbienen schon über eine Million. Unter den Säugetieren beginnt es bei den Ratten mit 200 Millionen Neuronen, Menschen haben um die 100 Milliarden, davon ungefähr 20 Milliarden im zerebralen Cortex, dem entwicklungsgeschichtlich jüngsten Teil des Gehirns. Die wahre Komplexität und die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns ergeben sich aber erst aus den unzähligen Querverbindungen zwischen den Neuronen.
Obwohl unser Gehirn so komplex ist, dass wir es trotz vieler Versuche kaum verstehen, ist es gleichzeitig zu klein, um die Komplexität der uns umgebenden Realität auch nur annähernd komplett und angemessen zu erfassen, meinen die Autoren. Entscheidend sei daher die Fähigkeit zur Abstraktion und zur Generalisierung. Das kausale Denken befähige uns dazu: Das sei unsere Art von logischem Denken über die Welt – und nicht die propositionale Logik, die mittels Deduktion die Entscheidung erlaubt, ob eine Aussage wahr oder falsch ist.
Kausales Denken: Vorwärts und rückwärts
Die Voraussage des Effekts einer Handlung („forward reasoning“) erfordere, sich darüber klar zu werden, wie eine Ursache eine Wirkung erzeugt und welche Faktoren oder Aspekte eine gewünschte Wirkung verhindern. Uns interessiert dann die Voraussage der Zukunft, also wie ein Ereignis heute ein Ereignis morgen verursacht.
„This is what the mind is designed to do. Whether we are thinking about physical objects, social systems, other individuals, our pet dog—whatever—our expertise is in determing how actions and other causes produce effects.“ 4
Herauszufinden, warum etwas geschehen ist („backward reasoning“), erfordert ein Nachdenken darüber, welche Gründe möglicherweise zu einem Ereignis geführt haben könnten. Darin seien wir Menschen immer noch ganz gut, aber bei weitem nicht so gut wie beim kausalen Denken in der Vorwärtsrichtung.
Den Autoren nach brauchen wir uns gar nicht all die kleinen Details der Wirklichkeit merken: Stattdessen lernen wir aus der Erfahrung und generalisieren. Dann können wir auch in unbekannten Kontexten agieren, ohne uns mit all den komplizierten und schwierigen Details befassen zu müssen, und bleiben auf diese Weise handlungsfähig.
Wie Menschen denken
Individuelle Intuition und kollektive Überlegung
Auch Sloman und Fernbach treffen die wichtige Unterscheidung zwischen System 1 und System 2, die David Kahneman in seinem heute schon klassischen Buch5 über schnelles und langsames Denken ausführlich erläutert hat: Sie unterscheiden zwischen der Intuition (System 1, schnelles Denken) und der Überlegung („deliberation“, System 2, langsames Denken) und begründen ausführlich, dass diese Unterscheidung in verschiedenen Ausprägungen schon von vielen Denktraditionen getroffen wurde.
Intuitives Denken sei eine sehr individuelle Art zu denken, schreiben die Autoren, sie existiere nur in unserem eigenen Kopf.
Etwas zu überlegen oder zu bedenken erfordere demgegenüber die Reflektion darüber, was wir a) selbst wissen, über Fakten, über die wir b) nur flüchtig und oberflächlich etwas wissen und c) über das Wissen in den Köpfen anderer Menschen. Wenn wir etwas überlegen, dann redeten wir mit uns selbst wie mit einer anderen Person. Etwas zu bedenken, verbinde uns also mit anderen Menschen. Intuition (System 1) geschähe nicht in Gruppen, sondern individuell, aber es sei möglich, gemeinsam etwas zu bedenken (System 2).
Denkmittel: Umwelt, Körper und Gefühle
Sie erinnern sich an die banale Situation am Anfang dieses Beitrags? Wenn nicht, scrollen Sie einfach zurück zum Anfang des Artikels. Wie die beiden Autoren schreiben: Kein Mensch muss sich jedes kleine Detail merken, solange wir jederzeit in der Lage sind, darauf zuzugreifen, indem wir z.B. das Internet befragen, auf unsere Smartphones schauen, altmodisch ein Telefonbuch benutzen, in unserem Taschenkalender nachschlagen, aufschauen, um nachzusehen, wo wir unser Glas hingestellt haben, oder nach draußen gehen können, um nach der Katze zu rufen. Auch die von uns angefertigten Dinge (von Experten produziert, die das können) lassen sich meist in ihrer Funktionsweise durch „scharfes Hinsehen“ erschließen. Wir brauchen nicht jederzeit alles in unserem Hirn präsent zu haben, wir können einfach nachschauen. Die Welt, auf die unser Blick gerade fällt, macht (meist) Sinn und verhält sich (fast) immer so wie wir es erwarten.
- Wir verwenden unsere Umgebung als externalisierten Gedächtnisspeicher
- Wir benutzen die Welt als Computer, indem wir unsere Aktionen anhand dessen planen, was wir visuell wahrnehmen. Statt z.B. die parabelförmige Flugbahn eines Baseballs auszurechnen (erfordert das Lösen von Differentialgleichungen), um zu ermitteln, wo wir sein müssen, um ihn fangen zu können, wenn der Ball herunterkommt, reicht es aus, uns während das Laufens so zu bewegen, dass unser Blickwinkel zum Ball mit einer konstanten Rate zunimmt und immer steiler wird
- Wir denken mit Hilfe unseres Körpers, etwas, das „Embodiment“ genannt wird und vielfach belegt ist: „thought is more effective when it is done in conjunction with the physical world“
- Nicht nur unser Körper, auch unsere Gefühle helfen uns beim Denken, insbesondere bei der Fokussierung unserer Aufmerksamkeit, einer sehr begrenzten Ressource, mit der sparsam umgegangen werden muss
- Oft ersetzen unsere emotionalen Reaktionen uns sogar das Denken6
So gesehen ist unser Gehirn nur ein Teil eines Verarbeitungssystems:
„The brain and the body and the external environment all work together to remember, to reason, and make decisions. The knowledge is spread through the system, beyond just the brain.“
Kollektives Denken
Wenn die Antwort nicht in uns selbst oder der Umwelt zu finden ist, können wir unsere Partnerin befragen, einen Freund anrufen oder eine Handwerkerin beauftragen, unsere Waschmaschine zu reparieren, usw. Als Individuen wären wir zudem kognitiv völlig überfordert, jede einzelne Tatsache, jede Information und Meinung selbst zu überprüfen. Daher verlassen wir uns bei vielen wichtigen Entscheidungen auf die vorherrschende Meinung in unserer Peergroup, „the community shapes our beliefs and attitudes“, wie die Autoren schreiben: “We let our group do our thinking for us.“
Die „division of cognitive labor“ ist kein modernes Phänomen, seit Anbeginn unserer Zivilisation gibt es Arbeitsteilung, gibt es Experten, die sich auf eine bestimmte Fähigkeit oder Aufgabe spezialisiert haben und diese sehr viel besser beherrschen als andere. Diese Spezialisierung erfordert aber Zusammenarbeit, um entweder die Ergebnisse der eigenen Arbeit anderen zur Verfügung zu stellen oder die Ergebnisse anderer Menschen Arbeit nutzen zu können. Nur so können Menschen mehr leisten und vollbringen, als ein einzelnes Individuum alleine vermag. Die Autoren betonen7, diese Zusammenarbeit in großen Gruppen erfordere die Entwicklung von Fähigkeiten, die aufeinander aufbauen und die man bei anderen Lebewesen nicht beobachten kann:
- Die Fähigkeit, Schlüsse über den Geisteszustand anderer Menschen zu ziehen, darüber, was andere beabsichtigen, was sie glauben und welchen Charakter sie haben
- Geteilte Aufmerksamkeit
- Gemeinsame Ziele, sprich: geteilte Intentionen
Vor allem wenn gemeinsame Ziele verfolgt werden, unterstütze dies die Sammlung von Wissen und dessen generationenübergreifende Weitergabe, welche die Grundlage unserer „kumulativen Kultur“ seien und die Weiterentwicklung der Menschheit (mehr kollektiv als individuell) ermöglichten. Diese „Community of Knowledge“ habe eine Reihe von Konsequenzen:
- Wenn in einer Gruppe wichtige neue Ideen entstehen, ist es im Allgemeinen schwierig, einen einzelnen Urheber dafür zu benennen.
- In einer „Wissensgemeinschaft“ ist der Zugang zum bzw. der Zugriff auf das Wissen der Gemeinschaft wichtiger als das individuelle Wissen.
- Die verschiedenen Teile des Wissens, die von unterschiedlichen Mitgliedern der Gemeinschaft gewusst werden, müssen zueinander kompatibel sein.
- Das menschliche „Verständnis“ besteht oft einfach aus dem Bewusstsein, dass das Wissen irgendwo existiert.
- Ein „tieferes Verstehen“ besteht normalerweise darin, auch zu wissen, wo das gerade benötigte Wissen zu finden ist.
Kurz vor Schluss
Ich habe in diesem Beitrag einige Themen des Buches ausgelassen und mir die Freiheit genommen, meiner subjektiven Perspektive folgend, eigene Prioritäten zu setzen. Ich gehe z.B. nicht darauf ein, wie wir nach Auffassung von Sloman und Fernbach mit Hilfe von Technologie denken, wie individuelles und kollektives Denken im Kontext von Wissenschaft und Politik stattfindet, wie nach ihrer Ansicht eine bessere Definition von Intelligenz und ihre Messung aussehen könnte und wie sie glauben, wie man Menschen und ihre Entscheidungen schlauer machen könnte.
Allerdings würde ich gerne die drei zentralen Thesen des Buches noch einmal hervorheben:
- Individuell und ohne die Hilfsmittel, auf die wir uns beim Denken unbewusst verlassen, sind wir ignoranter als wir denken: Wir halten uns für kompetenter als wir sind.
- Wenn wir glauben zu verstehen, erliegen wir oft nur einer Illusion.
- Wirkliche Kompetenz ist kollektiv und nutzt die Wissensgemeinschaft der Menschheit.
Ich glaube, jede dieser Thesen trifft zu.
Ich folge auch den Autoren in ihrer Analyse, dass das wirkliche Problem nicht darin besteht, dass wir als Einzelne so wenig wissen, sondern darin, dass uns dies nicht klar ist: Wir sind alle nur Zwerge – auch wenn einige von uns etwas größer sind und über die Zipfelmützen der anderen hinweg ein wenig weiter sehen können als die anderen.
Soweit für jetzt.
-
Sloman, S., & Fernbach, P. (2017). The Knowledge Illusion: The myth of individual thought and the power of collective wisdom. London: Pan Macmillan. ↩
-
Wikipedia contributors. (2019, April 23). Standing on the shoulders of giants - Wikipedia. Abgerufen 26. April 2019, von en.wikipedia.org/wiki/Standing_on_the_shoulders_of_giants. ↩
-
Mir gefällt in diesem Zusammenhang der Ausdruck „Scheinriese“. Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit und haben sie „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ gelesen oder im Fernsehen bei der Augsburger Puppenkiste gesehen? – Die beiden Titelfiguren treffen den Scheinriesen Tur Tur in der Wüste; ihn zeichnet aus, dass er immer größer wird, je weiter man sich von ihm entfernt und immer kleiner, bis auf das normale menschliche Maß, je näher man ihm kommt. ↩
-
Sie haben hoffentlich die wichtige Rolle von Haustieren in diesem Zusammenhang bemerkt. ↩
-
Kahneman, D., & Schmidt, T. (2012). Schnelles Denken, langsames Denken. München: Siedler Verlag. ↩
-
Holle, M. (2019, Oktober 27). Schnelles und langsames Denken /1: System 1 und 2. Abgerufen 4. Januar 2020, von warum-nicht-anders.org/bits/bit-2019-10-27-schnelles-und-langsames-denken-1-system-1-und-2 ↩
-
Sloman und Fernbach berufen sich dabei auf den russischen Psychologen Lew Semjonowitsch Wygotski, siehe auch: de.wikipedia.org/wiki/Lew_Semjonowitsch_Wygotski. ↩
(19.680 Zeichen)